Einen kurzen Augenblick hatte man den Eindruck, selbst Zaungast bei den Koalitionsverhandlungen der neuen Ampel ein zu sein. So grundsätzlich und weltanschaulich wurde unversehens das Sachthema Innovationspolitik diskutiert. Als säßen sich politische Lager gegenüber und müssten sich auf tiefgreifende politische Kompromisse einigen. Tatsächlich saßen am Tisch auch Vertreter jener zukünftigen Regierungspartner, die von sich behaupten, den weitesten Weg aufeinander zugehen zu müssen. Und mit Anna Christmann von Bündnis 90/Die Grünen und Thomas Sattelberger aus der FDP sogar langjährige Mitglieder im zuständigen Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung, zudem beide auch Unterhändler ihrer Parteien in den Verhandlungen. Schon diese Konstellation versprach Spannung, aber auch Orientierung über den neuen Kurs der Regierung in Sachen Innovationspolitik.
Noch am Vorabend der Veröffentlichung des neuen Koalitionspapiers hatte die Bertelsmann Stiftung deshalb zu ihrem traditionellen Berliner Kolloquium zu diesem Thema geladen. Zwar waren auch hier die Verhandlungsteilnehmer noch zum Schweigen verdonnert, dennoch wurde schon bald hörbar, wo sich die neuen Partner weiterhin unterscheiden – und doch gleichzeitig bereits aufeinander zu bewegen.
Vielleicht noch als Echo des zurückliegenden Wahlkampfes rangen die Diskutanten aber zunächst engagiert um grundsätzliche Deutungsmuster, um die Rolle von Staat und Markt bei der Förderung jener Innovationen, die es zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen braucht. Inspiriert durch ein Impulsreferat von Dr. Jan Breitinger, Innovationsexperte der Stiftung, der die Handlungsempfehlungen der Stiftung und des Fraunhofer Instituts für einen neuen Kurs zur Diskussion stellte. Vor allem aber auch durch Sylvia Schwaag Serger, Professorin an der Universität Lund. Die international renommierte Wissenschaftlerin, früher unter anderem für die schwedische Innovationsagentur Vinnova tätig, berichtete hier aus ihrer neuesten Forschungsarbeit, einer systematischen Analyse „transformativer Innovationspolitiken“ in verschiedenen europäischen Staaten. Ihr realistisches Zwischenfazit der aktuellen Ansätze: In mehreren Staaten gäbe es eine stark normativ geprägte und engagiert getragene Initiativen zu einer solchen transformativen Politik. In der Praxis würden die untersuchten Länder diesem starken Anspruch noch nicht gerecht. „Es hapert zu häufig bei der interministeriellen Koordinierung, und gerade angesichts eines starken Fokus auf die Finanzierung von Innovation und ausgeprägten Ressortdenkens erscheint es schwierig, Förderlinien neu auszurichten.“ Missionen scheiterten häufig daran, dass jede Regierungseinheit ihre eigenen Missionen definiere. Gleichzeitig fehle der Mut zum Risiko, zum Experiment. Doch wer Innovationen anstoßen wolle, brauche ein Mandat zum Risiko. Eine Kultur, die Regierungsbehörden auch etwa im schwedischen System durchaus widerstrebe.
Diese Einschätzung bestätigten wiederum die Skeptiker im Raum, die sich traditionell einer starken Rolle des Staates bei politisch angestrebten Missionen, in Wissenschaft und Forschung oder der Idee einer Innovationsagentur widersetzen. Die Ursache von zu wenig Effizienz in der Innovation sei eben die zu starke Rolle der Exekutive. Bevor man über Agenturen rede, solle man besser darüber nachdenken, wie sich ein bestehendes Ministerium zunächst selbst „agilisieren“ könne. Die normative Ausrichtung von Forschung und Innovation, die rationale Zielsetzung dürfe nicht zu dominant werden. Die Antwort auf die mangelnde Risikobereitschaft und für ein „Mandat zum Scheitern“ sei doch die Stärkung des Unternehmertums und der eigenverantwortlichen Initiative sowie die Befreiung des agilen Entrepreneurs von bürokratischer Bevormundung. In Deutschland setze man jedoch nicht auf Unternehmertum, sondern auf Strukturvorschläge, Etatismus und Dirigismus. Anstatt durch mehr Freiheit zum Erfolg zu kommen, verordne der Staat mit der Missionsorientierung noch mehr Orchestrierung.
Für andere Perspektiven, noch mehr rationale Diskursvorschläge, politische Kompromissvorschläge und Ruderbewegungen in der Runde sorgten schließlich mehrere Dutzend teilnehmende Experten. Unter ihnen als weitere Impulsgeber Dr. Marc Bovenschulte, Bereichsleiter Demografie, Cluster und Zukunftsforschung vom VDI/VDE Innovation + Technik, oder Philipp von der Wippel, Gründer und Managing Director von Project Together.
Sie verwiesen dabei darauf, dass der bestehende Betrieb mit enger Anbindung an staatliche Vorgaben im internationalen Vergleich auch grundsätzlich nicht gerade schlechte Ergebnisse vorzuweisen habe. Die Rankings widersprächen klar dem gefühlten Niedergang der deutschen Innovationsperformance. Grundsätzlich sei gegen die Aufnahme neuer Akteure und die Beteiligung der Zivilgesellschaft nichts einzuwenden, aber man müsse aufpassen, keine „bürokratischen Monster“ zu schaffen. Es müsse vielmehr darum gehen, das gesamte Innovationssystem auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Seien es Missionen, sei es Partizipation, seien es bestimmte Fördermethoden. Eine bessere Koordination und die Aufnahme weiterer Communities oder Akteure seien dabei eigentlich selbstverständlich. Die neuen Herausforderungen könne man tatsächlich auch nicht durch die Gründung neuer Agenturen lösen. Die Forderung: Es sei eine harte wie auch partizipativ angelegte Diskussion darüber notwendig, wie eine neue Förderpolitik aussehen müsse. Immer unter der Frage: Was gewinnt man und was verliert man mit neuen Agenturen?
Diese konservierende Haltung fand wiederum vielfachen Widerspruch: „So wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Der Rückblick auf die Zukunftsinitiativen der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass jene Innovationen, die aus den Bundesministerien organisiert wurden, nicht gut funktioniert hätten. Die Hightech-Strategie der Bundesregierung sei eher eine Projektschau, aber keine Strategie gewesen. Und auch fehlende Mittel oder Freiheiten seien eben nicht der Grund für zu wenige effektive Innovationen gewesen, sondern die mangelnde Governance und Steuerung. Auf diesem Weg versickere danach Geld in zu viele kleinteilige Fördertöpfe der verschiedenen Ministerien oder könne erst gar nicht ausgegeben werden. „So wird daraus kein Game Changer“, so die Einschätzung, und dies werde dann auch den Anforderungen an Innovationen nicht gerecht. Um tatsächliche Missionen zu erfüllen, müsse die Zersplitterung überwunden werden. Die Forderung: Wir brauchen agile Agenturen, die eine bessere Vernetzung zwischen den Sektoren Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik leisten könnten. Auch soziale Innovationen, die dabei gerne unterschlagen werden, könnten von Agenturen besser induziert werden als von Ministerien.
Mit den Innovationsagenturen sollten darüber keine „bürokratischen Monster“ geschaffen werden, so eine weitere Ergänzung, sondern agile und flexible Lösungen. Keine Institutionen, die alles zentral wie ein Magnet an sich ziehen, sondern orchestrieren. Bislang gäbe es viele gute Initiativen, die aber eher nur nebeneinander agierten, so wie es Unternehmen, Wissenschaft, Startups und Zivilgesellschaft oft ebenfalls täten. Innovationsagenturen sollten Vernetzungsarbeit leisten wie „die Spinne im Netz“. Eine Institution, die ermögliche. Innovationsagenturen solle man sich nicht als Ersatz von staatlicher Steuerung oder unternehmerischer Initiative vorstellen, sondern als Ergänzung und Katalysator.

Ergebnisse der internationalen Innovationsstudie und Handlungsempfehlungen für Deutschland
© Foto: Bertelsmann Stiftung
Das Problem der aktuellen Herausforderungen sei aber auch Zeitfaktor. Angesichts etwa des Klimawandels bedürfe es schnelle Lösungen: „Dafür brauchen wir aber auch gewisse geförderte Korridore und Aufträge, die sicherstellen, dass die angestrebten Ziele wirklich erreicht werden. Das schafft der Markt offensichtlich nicht allein. Es gibt zu wenige avantgardistische Unternehmen, die sich hervortun, weil sie etwa das Klimaproblem in den Griff bekommen.“
Ähnlich wie vermutlich bei den Koalitionsverhandlungen verlor der polarisierte Gegensatz von Staat versus Markt im weiteren Verlauf dieses Kolloquiums seine Absolutheit. Es gehe bei Innovationspolitik im Kern nicht um das Problem, ob der Markt die Kreativität oder die Kraft habe, Innovationen hervorzubringen und zu bewältigen. Selbstverständlich brauche es den Markt und das Unternehmertum. Die Frage laute, ob der Staat solche Kraft und Initiativen einenge oder sie befördere. „Bisher ist der Staat bei Innovation oft nicht fördernd, sondern er bremst, weil er Innovationspolitik viele Regeln unterwirft, die einfach nicht passen.“ Als Beispiel wurde die Agentur für Sprunginnovationen Sprin-D angeführt, deren Freiraum in der neuen Legislatur erweitert werden müsse.
Innovationsagenturen könnten zudem die Aufgabe haben, Lösungen in den gesellschaftlichen Diskurs einzuspeisen, die in den Medien kaum oder gar nicht diskutiert werden, ebenso wie Lösungen, für die es bislang keinen Markt gäbe. Die Agenturen stünden dabei in einem unmittelbaren Kontakt mit Endnutzer und der Zivilgesellschaft, sie erfüllten die wertvolle Aufgabe, frühzeitig Probleme und gleichzeitig Lösungen zu identifizieren, die bislang wenig bekannt seien.
Auch der gern in diesem Kontext vorgebrachte Gegensatz zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung sei nicht mehr zeitgemäß. Es brauche eine freie Wissenschaft und Forschung genauso wie auch ein freies Unternehmertum. Das schließe aber nicht aus, bestimmte Innovationen zu definieren und zu bestimmen, wo es einen gewissen Handlungsdruck gebe, beides müsse in Interaktion sein. Dabei wurden vielfach nachahmenswerte Beispiele der Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft etwa aus Großbritannien und Schweden wie in Oxford, Cambridge oder Lund ins Feld geführt. Das deutsche Vorzeigebeispiel der TU München beweise deutlich, dass für solche Innovationsökosysteme wiederum große Summen öffentlicher Gelder zur Verfügung stehen müssten.
Vertreter der aktiven Zivilgesellschaft verwiesen auf die Innovationskraft regionaler und basisorientierter Initiativen, die in den bisherigen Strukturen wenig genutzt werde und die nicht zur Entfaltung kämen. Beispiele dafür seien die von Project Together mitinitiierten Projekte „WirvsVirus“ oder „Update Deutschland“. Dabei entstünden in Experimentierräumen neue Lösungsansätze, die vielleicht auch schon im Kleinen funktionieren, und die zusammenkämen mit privatwirtschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Skalierungsoptionen. Zukünftig sollten sich staatliche Institutionen mehr für solche Experimente und Reallabore öffnen. Es sei offensichtlich, dass derlei Ansätze eigentlich ins öffentliche System gehörten und der öffentlichen Hand wiederum gar Ressourcen einsparen könnten.
Bis zum Schluss der Veranstaltung hielten die „Koalitionäre“ zu Einzelheiten des Regierungspapiers dicht. Zwischen den Zeilen waren jener Kompromiss und Kompass erkennbar, der zeitglich in Berlin zu Papier gebracht wurde: Das Ziel der Erneuerung und der Innovation soll es sein, die großen Chancen zu nutzen. Und die Freiheiten zu erweitern, für jene, die schon einmal vorangehen wollen: Unternehmen, Wissenschaftlerinnen und Zivilgesellschaft. Gleichzeitig muss der Staat Impulse zur eigenen Modernisierung aufgreifen. Die Vorschläge zur Missionsorientierung laufen dabei nicht darauf hinaus, diese Freiheiten einzuschränken. Sie sollen vielmehr die drängenden Herausforderungen unserer Zeit gezielt durch Innovation adressieren. Besonders dort, wo für die Beteiligten ein hohes Risiko oder wenig Attraktivität besteht, diese Felder selbst zu bespielen.
Der am nächsten Tag veröffentlichte neue Koalitionsvertrag präsentierte dann überraschend viele Gedanken dieses Kolloquiums noch einmal Schwarz auf Weiß.





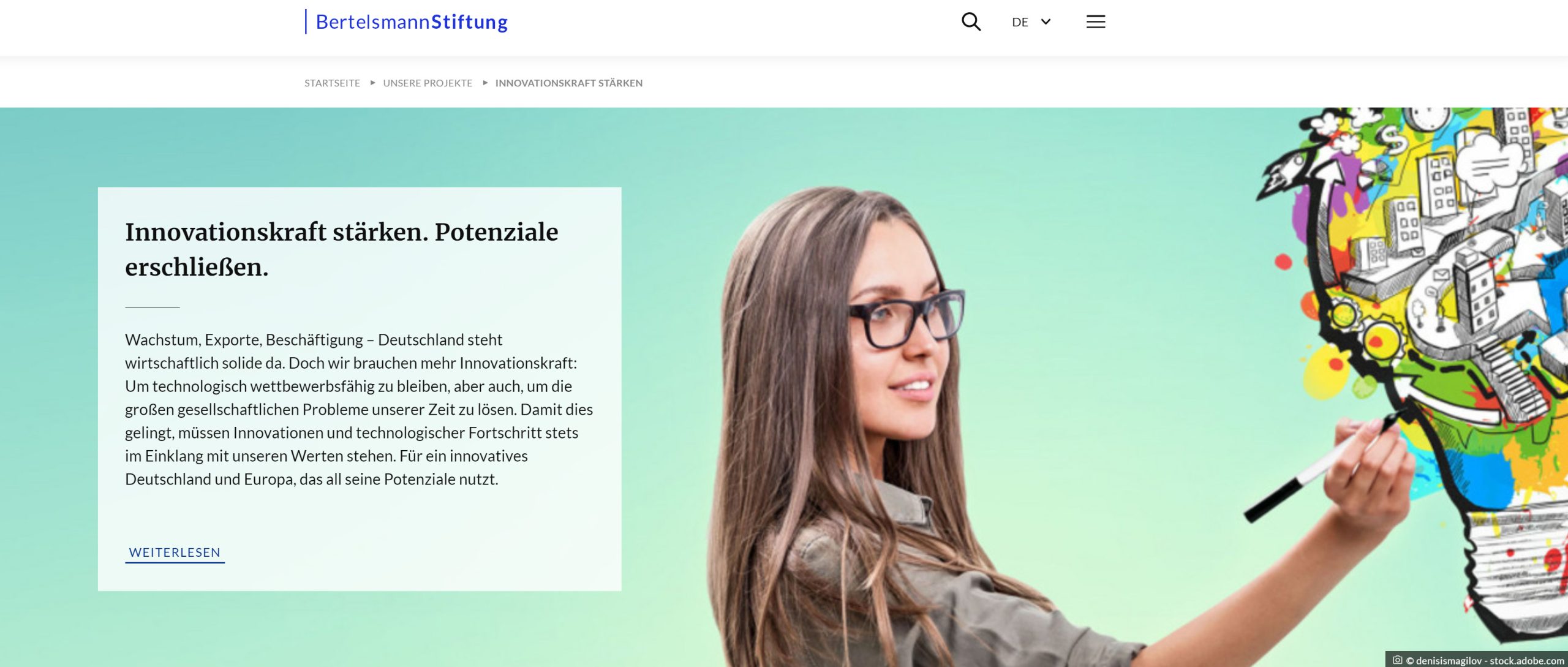




Kommentar verfassen