Frage: Warum tun sich Deutschlands Universitäten so schwer beim Thema Transfer und Innovationen aus der Wissenschaft?
Prof. von Grünberg: Viele andere Länder haben mehr als eine öffentlich finanzierte Förderinstitution für die Wissenschaft. In Deutschland aber haben wir uns im Wesentlichen nur auf eine einzige Institution beschränkt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die die Grundlagenforschung, weniger den Transfer und die Anwendung fördert. Wir haben zwar zum Beispiel exzellente technische Universitäten, aber trotzdem dominiert doch insgesamt eher ein Wissenschaftsbegriff, wo das Streben nach „reiner“ Erkenntnis und das Suchen und Finden von Wahrheit im Vordergrund steht. Viele tun sich noch schwer, die wissenschaftliche Suche nach Lösungen für praktische Probleme auch als Wissenschaft zu begreifen. Natürlich betreibt man auch dann Wissenschaft , wenn man ein gegebenes praktisches Problem wissenschaftlich zu lösen hilft oder z.B. seine Methodik so weit ausarbeitet, dass Unternehmen daraus ein Produkt machen können. Wissenschaft bedeutet doch bitte schön weit mehr als nur Papers schreiben und an Konferenzen teilnehmen! Das wird doch im Zeitalter von Corona und den Grand Challenges mehr als deutlich.
Wie kam der Transfer an die Universitäten?
Die Entwicklung der Universität hat historisch mehrere Stufen durchlaufen: Während sich die Hochschulangehörigen vor Humboldt als Gelehrte betrachteten, die ausschließlich fertiges Wissen bewahrten und an die nächste Generation weitergaben, kam mit Humboldt die Idee auf, Forschung und Lehre miteinander zu verbinden. Humboldt hat gesagt, dass Universitäten die Wissenschaft immer „als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem“ behandelten und daher „immer im Forschen“ blieben, während Schulen es nur mit fertigem Wissen zu tun hätten. Schulen erziehen also mit fertigem Wissen, Hochschulen hingegen mit unfertigem Wissen, genauer: mit der Teilhabe an dem Prozess des „Wissen-Schaffens“. Mit diesen preußischen Universitätsreformen trat also als neue Leistungsdimension einer Universität die Forschung (also das Generieren von Wissen) neben die Lehre (also die Weitergabe von Wissen). Der Transfer nun ist die neue, die dritte Mission einer Hochschule: nämlich die Verfügbarmachung von Wissen. Gewonnenes Wissen nun auch in die Nutzung, in die Anwendung bringen. Das ist dann die moderne Trias einer Hochschule: Lehre, Forschung und Transfer. Dabei ergibt sich der Transfer nicht von selbst. Da holt sich niemand das Wissen von einer Uni ab, sondern es ist ganz klar eine Bringschuld der Hochschule gegenüber der Gesellschaft! Dies wird erst in den letzten Jahren klar so erkannt. Und das wird dazu führen, dass auch der Transfer in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in Deutschland einen Siegeszug innerhalb der Wissenschaftslandschaft antreten wird.
Nach einer Auswertung des Stifterverbandes ist für neun von zehn Universitäten Transfer aber weiterhin mehr ein schönes Leitbild als gelebte Praxis.
Es ist nun mal ein junges Pflänzchen. Bis Ende der 90er Jahre kam Transfer eher unter „ferner liefen“. Die Geburtsstunde des Transfers als dritte Säule schlug tatsächlich erst 2014 mit dem Papier des Deutschen Wissenschaftsrates „Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems“. Und seitdem rollt der Zug, eindeutig.
Beim Transfer von Wissenschaft in die Wirtschaft fällt auf, dass in Richtung Großunternehmen schon vieles gut funktioniert, aber insbesondere KMUs wenig innovieren und den Wissensschatz der Hochschulen nicht richtig zu nutzen wissen. Was ist die Ursache?
Bis vor zehn, zwanzig Jahren konnten Unternehmen immer noch individuell, mit eigenen Ressourcen, im Kleinen, Schritt für Schritt und inkrementell innovieren. Quasi im stillen Kämmerlein und mit eigenen Ingenieuren. Das ist seit der Digitalisierung vorbei. Heute erwartet der Mark oft komplexe, hochintegrierte Lösungen, die nur durch die Zusammenführung spezialisierter Einheiten von weit verstreuten Organisationen hergestellt werden können. Die Marktanforderungen sind so komplex geworden, dass kleine und mittlere Unternehmen ohne Hilfe von außen zu innovieren sich oft schwertun. An die Stelle des „Allein besser sein wollen“ tritt jetzt die Philosophie „Nur mit anderen zusammen werden wir besser werden“. Stichwort: Open Innovation. Da rückt dann auch die öffentlich geförderte Universität und Wissenschaftslandschaft ins Blickfeld und die Unternehmen fordern: Wir wollen mehr, als Ihnen nur unser Steuergeld geben, wir wollen von den wissenschaftlichen Ergebnissen der staatlich finanzierten Forschungsinstitutionen unmittelbar profitieren.

© Foto: GLady auf Pixabay
Nach einer Erhebung des Stifterverbandes ermittelt nur ein Viertel der Hochschulen den Bedarf hinsichtlich ihrer Transfer- und Innovationsergebnisse. Forschen Universitäten nicht an den Bedürfnissen von Gesellschaft und Wirtschaft vorbei?
Na ja, als reine Produktionsstätte von Innovationen ist eine Universität nun mal nicht gedacht. Sie ist und bleibt zunächst der Ort der Wissenschaft und die Wissenschaft ist manchmal ja eher wie die „Blinde Kuh“, die stets den Erkenntnisinteressen der Beteiligten folgt und dabei zwar meist an irgendeinem Ziel ankommt, aber selten an dem vorab vorgestellten. Es wäre naiv anzunehmen, es gäbe da eine innere Logik, die nahtlos von wissenschaftlicher Erkenntnis zur technologischen Innovation führt. Vielmehr gehören Wissenschaft und Wirtschaft zwei völlig verschiedenen Teilsystemen an, die ganz unterschiedlichen Logiken folgen. Zum einen der Reputationslogik der Wissenschaft, die auf möglichst viele Papers in Journalen mit hohem Impact abzielt, zum anderen der Logik der Wirtschaft, die Geld verdienen und am Markt bestehen will. Die unterschiedlichen Systemgesetzlichkeiten machen den Übergang vom einen in das andere System so schwierig.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Transfer sind regionale Netzwerke. Trotz zahlreicher möglicher Kooperationsformate erfolgt Zusammenarbeit noch immer häufig individuell und ist abhängig vom Engagement Einzelner. Müsste Kooperation nicht vielmehr strategisch und institutionell organisiert erfolgen?
Eine ausgesprochen spannende Frage und die Antwort lautet vermutlich „Ja“. Man darf das auf keinen Fall dem Zufall überlassen. Für mich ist wichtig, dass die Universitäten ihr Mitwirken in Innovationsnetzwerken, eventuell gar das Organisieren und Orchestrieren dieser Netzwerke, als eine ihrer wesentlichen Aufgaben, als ihren Auftrag und als Teil ihres Portfolios zu verstehen lernen. Dafür muss es dann auch neue Formate geben: von mir sehr präferiert nicht zuletzt die Idee von „Transferprofessuren“. Und es muss neue Karrierewege geben, neue Belohnungssysteme, um ein dauerhaftes Engagement im Dienste des akademischen Transfers für den Nachwuchs auch wirklich interessant zu machen.
Ihr Name ist eng verknüpft mit dem Stichwort D´Innova, einem Konzept für Innovationsagenturen, die auch solche Netzwerke für den Transfer zwischen Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft schaffen sollen. Und mit der Bundestagswahl ist ein Teil dieses Konzeptes auch in das Koalitionspapier der Ampel aufgenommen worden, Stichwort DATI. Ist das Thema Transfer am Ziel, wird jetzt alles gut?
Ich war natürlich begeistert vom Koalitionsvertrag und habe eine Flasche Wein aufgemacht, als ich erfahren habe, dass es eine „Deutsche Agentur für Transfer und Innovation“ (DATI) geben wird. Jetzt konkretisieren sich die ersten Eckpunkte in der Planung der neuen Agentur, also z.B. die Idee der „Innovationscommunities“, die als Innovationsnetzwerke und Communities rund um die Hochschulen zu verstehen sind. Man muss aber aufpassen, dass das nicht in Richtung regionale Wirtschaftsförderung abgleitet. Die DATI ist ja als eine Wissenschaftsförderung gedacht, die neue Wege für die Wissenschaft eröffnet, die eben auch jungen Akademikern neue Förderformate, Karrierewege und Reputationsmöglichkeiten bieten soll. Es muss insgesamt eine Förderprogrammatik werden, die auch auf die Wissenschaft und ihre Reputationslogik zurückwirkt, sonst ist die DATI keine wirklich überzeugende Ergänzung zur DFG.

© Foto: kiquebg auf Pixabay
Kann die DATI den Graben zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Logiken überbrücken?
Werden wir sehen. Die Idee, ganze Innovationsnetzwerke zu fördern, ist schon mal gut. Will man aber eine Förderinstitution, die eine Anreizwirkung hinsichtlich des akademischen Transfers hat, will man, dass sich das Engagement für Innovation und Transfer auch für junge Nachwuchswissenschaftler wirklich lohnt, dann muss die Förderung am Ende unbedingt reputationswirksam sein. Reputation aber gewinnt immer nur der Einzelne, nie eine Community. Soll heißen: Man wird sich überlegen müssen, wie man einerseits Netzwerke von Gruppen fördern will und andererseits die Karrieren Einzelner, die ja mit einer DATI Förderung einen Reputationsgewinn verbuchen wollen. Diesen Zielkonflikt konstruktiv aufzulösen, scheint mir das Gebot der Stunde. Ich würde vorschlagen, dass man einen Teil des Budgets – vielleicht 30-40 Prozent – für die Einzelförderung von Wissenschaftlern reserviert. Gleichzeitig werden diese aber in die Pflicht genommen, mit ihrer Wissenschaft auch Beiträge zu einer bestehenden Innovationscommunity zu leisten. Dann könnte dabei etwas sehr Besonderes herauskommen.
Ist damit dann das Problem mit der Reputationslogik gelöst und der Weg frei für die Third Mission? Werden jetzt alle Hochschulen zu Transfer- und Innovationsunis?
Wir haben mit Lehre, Forschung und Transfer drei Leistungs- und Differenzierungsdimensionen für die Hochschulen, also einen dreidimensionalen Zustandsraum, in dem sich jede Hochschule mit ihrem je eigenen Profil selbst positionieren und von anderen abheben kann. Jeder Punkt steht da für eine Universität oder eine HAW. Wir sollten aufhören, alle gleich sein zu wollen. Wir sollten aufhören, die Institutionen in unserem Hochschulsystem stets in eine Rangliste bringen zu wollen. Wir sollten vielmehr eine Lust auf Vielfalt entwickeln. Ich bin ein absoluter Fan von einem maximal ausdifferenzierten Wissenschaftssystem. Diese Komplexität müssen wir im Jahr 2023 doch auch einmal zulassen. Zu Ihrer Frage: Ja, es wird jede Uni und HAW den Transfer und die Gründung als Profilmerkmal haben. Aber mal mehr und mal weniger. Da darf es keine einheitliche Antwort geben. Aber ich habe das Gefühl, dass über den Transfer, über Gründungen, über Innovationen, über unseren Beitrag zu den SDGs jetzt jeder an der Universität, auch unter den Studierenden nachdenkt, das ist einfach ein Thema.
Nachdenken ist das eine, viele Universitäten gehen inzwischen auch weiter. Hier in Potsdam setzt man sehr stark auf den Transfer und es gibt mit Ihnen einen ausgewiesenen Lehrstuhlinhaber für das Thema. Wie wird man damit zu einer Transferuniversität und wie sieht diese Disziplin dann in der Praxis aus?
Meine Professur heißt Wissens- und Technologietransfer. Es geht dabei aber nicht um Transferforschung als Teil der Hochschulforschung. Es ist vielmehr eine Transferprofessur: wie die Lehrprofessur sich vorrangig um die Lehre kümmert, so soll die Transferprofessur den Transfer aktiv betreiben. Also: nicht schreiben, sondern machen! Das bedeutet im Alltag vor allem viel Management rund um die Kooperationen mit Dritten, um Infrastruktur, Ressourcen oder immer wieder die Entwicklung einer Reihe von neuen Transferideen. Der anspruchsvollste Teil meiner Arbeit aber gilt der Lehre und der Vermittlung von Transferwissen. Es gibt ja bislang gar keine Lehrbücher zum Wissens- und Technologietransfer, sondern nur eine Menge meist langweiliger Papers. In diesem Semester beantworten wir diese Herausforderung zum Beispiel zusammen mit den Wirtschaftswissenschaftlern mit einer kombinierten Veranstaltung zum Transfer- und Innovationsmanagement, genannt TIM; einer Mischung aus Wissens- und Technologietransfer und Innovationsmanagement. In der Praxis vermitteln wir den Studierenden einmal den theoretischen Background. Parallel bearbeiten wir in den Übungen praxisorientierte Case Studies. Dazu nutzen wir die Neuentwicklungen, die hier auf dem Campus in den Fraunhofer Instituten entstehen, und fordern die Studierenden dazu auf, für eine Markteinführung dieser Prototypen detaillierte Transferkonzepte in Teams auszuarbeiten.
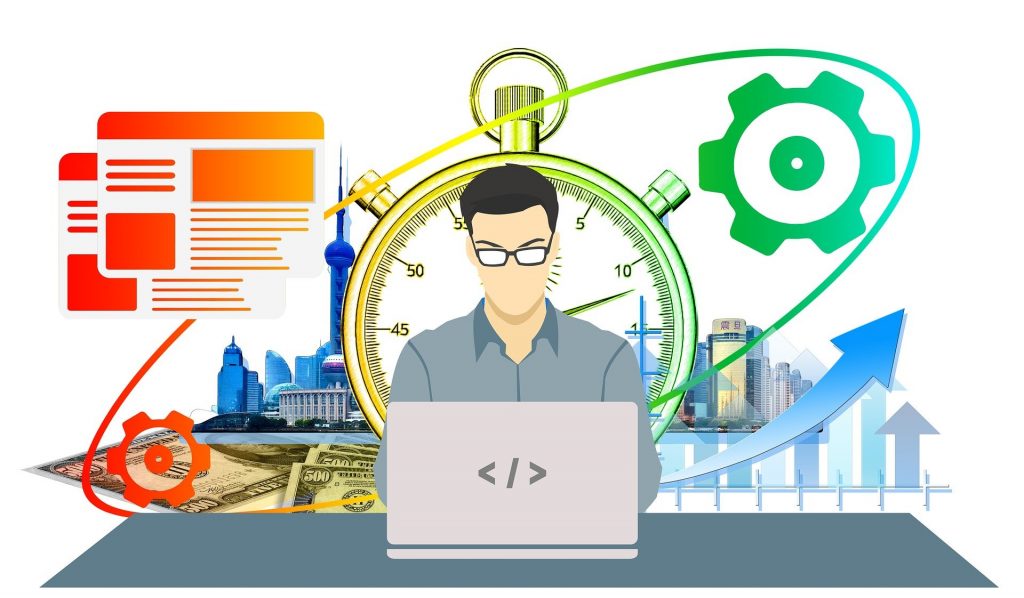
© Gerd Altmann Pixabay
Bei solchen Beschreibungen werden sofort Bilder geweckt, dass hier vor allem Wissenschaftsvermarkter für das Business rekrutiert werden sollen. Geht es von hier aus nicht schnurstracks zur Kommerzialisierung von Wissenschaft?
Der Transferbegriff umfasst heute weit viel mehr als nur den Technologietransfer: Dazu gehört die Politikberatung, es geht auch um den gesellschaftlichen Transfer, um soziale Innovationen, es geht um Relationship-Management bis hin zur Bereitstellung von wissenschaftlicher Infrastruktur, um die Zusammenarbeit mit Dritten anzureizen. Als Beispiel dafür nenne ich etwa bei uns an der Universität Potsdam den Schwerpunkt der Lehrerbildung. Sie versteht sich bei uns ebenfalls als Teil des Transfers, da sie ja wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die schulische Praxis fließen lässt. Dies als eigenen Auftrag einer Universität zu verstehen, ist das eigentliche Novum. Diesen Auftrag hat nun auch die humanwissenschaftlichen Fakultät für sich angenommen.
Interessant, denn gemeinhin gilt doch, dass gerade Geistes- oder Humanwissenschaftler dem Thema Transfer gegenüber besonders kritisch eingestellt sind. Haben Sie mit Ihrem Transfervirus den gesamten Campus infiziert?
Jede Fakultät hat ihren eigenen Zugang zum Thema. Eine mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät kann sich dem Technologietransfer ohne Probleme verschreiben, eine philosophische Fakultät hat es da schon schwerer, wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten wiederum sind schon sehr lange bei dem Thema Innovation und natürlich sehr nah dran am Thema Startups. Neu ist, dass die einzelnen Transferinseln in der Hochschule nun langsam zusammenwachsen. Einigen gelingt die Annäherung eben besser als anderen. Aber beispielsweise das Transferfeld „Politikberatung“ hat nicht zuletzt durch Corona neuen Rückenwind erfahren. Ein Umdenken hat eingesetzt zu der Frage: Was ist eigentlich von dem, was ich hier tue und forsche relevant für die Gesellschaft? Die gestiegenen Relevanzerwartungen einer zunehmend selbstbewusster werdenden Gesellschaft hat dem Transfer zu einer ganz neuen Bedeutung verholfen. Es gilt: Die Gesellschaft möchte von ihren Universitäten etwas haben. Und also bitte schön: Raus da aus der Nische, rein in die Mitte der Gesellschaft und sich dort nützlich machen!
Das Interview mit Professor Hans-Hennig von Grünberg ist die redaktionell komprimierte und autorisierte Fassung eines Audiopodcasts.
Professor Grünberg wird das Thema weiter vertiefen als Referent und Impulsgeber beim diesjährigen Online Forum des Centrums für Hochschul-Entwicklung. Gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung widmet es sich am 25. und 26. Januar dem Thema Transfer aus der Wissenschaft. An zwei aufeinanderfolgenden (jeweils halben) Tagen beleuchten wir Fragen des Transfers aus verschiedenen Blickwinkeln und stellen Beispiele aus der Praxis vor:
Der Tag 1, am 25.1.23 (9:30 – 13:30 Uhr) widmet sich zunächst schwerpunktmäßig der Ausbildung: Wie lassen sich Transferkompetenzen erfolgreich und zielgerichtet durch die Lehre und Trainings vermitteln? Daran schließt sich ein Fokus auf Transferformate an. Neben Beispielen aus Deutschland richten wir auch ein Augenmerk auf Beispiele aus dem Ausland.
An Tag 2, dem 26.1.23 (9:30 – 13:30 Uhr) verlassen wir die Hochschulmauern und wagen einen Blick in die Praxis: Matching & Vernetzung stehen am zweiten Tag auf der Tagesordnung, ebenso wie Fragen nach der (gesellschaftlichen) Wirkung des Transfers.
Für Studierende bieten wir eine Reduzierung des Kostenbeitrags an. Bitte kontaktieren Sie Frau Tegethoff bei Interesse unter (alexandra.tegethoff@che.de).
Anmeldeschluss: 20. Januar 2023
Weitere Infos und zur Anmeldung



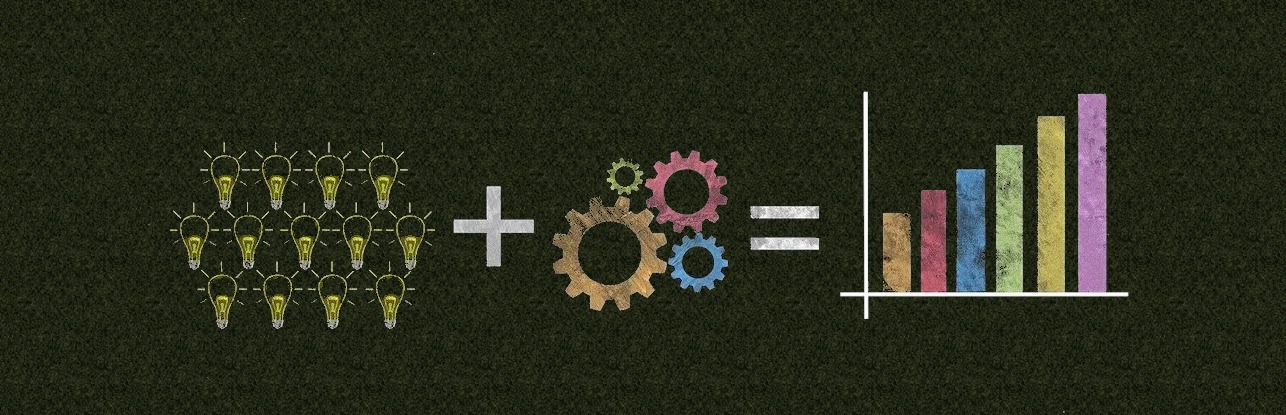





Kommentar verfassen