Mit dem Neuen Magischen Viereck schufen Dullien und van Treeck ein Instrument, das einen umfassenden Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Es stellt nicht nur dar, wie sehr die deutsche Wirtschaft wächst, sondern auch wie nachhaltig die Wirtschaftsentwicklung ist. Die Entwicklung wird anhand von vier Dimensionen dargestellt:
- materieller Wohlstand und ökonomische Stabilität
- Nachhaltigkeit der Staatstätigkeit und der Staatsfinanzen
- soziale Nachhaltigkeit
- ökologische Nachhaltigkeit
Jede Dimension wird mit drei bis fünf Indikatoren gemessen, die weitgehend Ziele aus Gesetzen und anderweitigen Verpflichtungen der Bundesrepublik abbilden. Im Jahresturnus wird ein Report dazu veröffentlicht.
Im aktuellen Report wird die Entwicklung seit 2019 gezeigt. Inmitten von Herausforderungen, wie der sich verstärkenden Klimakrise, Kriegen und inflationärer Entwicklungen, kann das Neue Magische Viereck helfen, die ökonomischen Folgen der Krisendynamiken besser zu erfassen.
Wie haben sich die zentralen vier Oberziele entwickelt?
Der aktuelle Report zeigt, dass nur vereinzelt Ziele des Neuen Magischen Vierecks realisiert wurden: Von den insgesamt 16 betrachteten Indikatoren konnten lediglich drei die angestrebten Zielwerte erreichen.
Materieller Wohlstand und ökonomische Stabilität
Hier wurden mehrere Unterziele verfehlt: Das BIP pro Kopf stagnierte zwischen 2019 und 2024 und blieb deutlich unter dem Zielwert von 1,25 Prozent Wachstum pro Jahr. Ähnlich sah es beim Konsum pro Kopf aus.
Die Inflation ist im Vergleich zu den Jahren 2022 und 2023 zwar wieder gesunken, lag aber auch 2024 über 2 Prozent. Der Leistungsbilanzüberschuss hat sich seit 2022 zielkonform entwickelt. Positiv hervorzuheben ist die stabile Entwicklung der Erwerbstätigenquote, die dank Kurzarbeit sogar über das Vorkrisenniveau hinausging.
Nachhaltigkeit der Staatstätigkeit und der Staatsfinanzen
Hier wurde keines der Ziele erreicht. Die Defizite und der Schuldenstand (in Prozent des BIP) sind im Zuge der Krisen deutlich angestiegen, während die Nettoinvestitionen zu gering geblieben sind.
Die geringen Investitionen gefährden den langfristigen ökonomischen Wohlstand und die ökologische Nachhaltigkeit. Die Bereitstellung grundlegender Leistungen, insbesondere im Infrastrukturbereich, und die klimaneutrale Umgestaltung des öffentlichen Kapitalstocks sind bisher unzureichend.
Soziale Nachhaltigkeit
In diesem Bereich zeigen sich ebenfalls Defizite. Keiner der vier Indikatoren erreichte zuletzt die Zielwerte. Besonders kritisch ist hier die Entwicklung der sogenannten Frühen Schulabgänger:innen. Das sind die 18- bis 24-Jährigen ohne Berufsabschluss, die nicht zur Schule gehen und sich nicht in Aus- oder Weiterbildung befinden und nicht über einen Abschluss des Sekundarbereichs II (zum Beispiel Abitur) verfügen. Die Zahl entfernt sich seit 2015 immer weiter von der Zielmarke von 9 Prozent und hat zuletzt über 13 Prozent erreicht.
Auch die Einkommensungleichheit nahm zu, während das Armutsrisiko seit 2021 leicht sank – jedoch 2023 immer noch drei Prozentpunkte über dem anvisierten Wert von 13,5 Prozent lag. Besser entwickelt sich dagegen der Verdienstabstand pro Stunde zwischen Frauen und Männern, der deutlich abnahm und sich somit weiter der Zielmarke nähert.
Ökologische Nachhaltigkeit
Hier wurde das Ziel der Verringerung der Treibhausgasemissionen zwischen 2019 und 2024 zwar erreicht, doch bei den anderen Zielen (Reduktion des Primärenergieverbrauchs und Ausbau der erneuerbaren Energien) blieb man hinter den Vorgaben zurück. Ein Großteil der Emissionsminderung dürfte zudem nur temporär sein, da sie vor allem durch eine Verringerung der Produktion erzielt wurden.
Zielkonflikte des Neuen Magischen Vierecks
Zwischen den genannten Dimensionen des Neuen Magischen Vierecks bestehen jedoch auch Zielkonflikte, die die jährlichen Reports darlegen. Ein wesentlicher Zielkonflikt, der immer offensichtlicher wird, besteht zwischen der Sicherung wirtschaftlicher Stabilität und den Schuldenregeln.
Schuldenbremse hemmt öffentliche Investitionen
Die bisherige Schuldenbremse im Grundgesetz sowie die europäischen Fiskalregeln setzen enge Grenzen für staatliche Defizite. Gerade in den Krisenjahren seit 2020 wurde jedoch deutlich, dass eine temporäre Ausweitung der Verschuldung, durch die man sich von den gesetzten Grenzwerten der Schuldenregeln entfernte, notwendig war, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Die Hilfsprogramme während Pandemie und Energiepreiskrise haben verhindert, dass der materielle Wohlstand noch stärker einbricht.
Ein weiteres Problem ist, dass die Schuldenregeln Zukunftsinvestitionen im Weg stehen. In Zukunft sind hohe Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung dringend erforderlich, die weit über die bisherigen jährlichen Investitionen hinausgehen. Der finanzielle Handlungsspielraum wird durch die restriktiven Fiskalregeln jedoch stark eingeengt. Zeitnahe Reformen der deutschen und europäischen Fiskalregeln, die eine höhere Verschuldung zugunsten staatlicher Investitionen ermöglichen, wären der ökonomischen Stabilität und dem langfristigen materiellen Wohlstand deutlich zuträglicher.
Aktuellem Wirtschaftsmodell fehlt Transformationsperspektive
Ein weiterer, zumindest temporärer Zielkonflikt betrifft die ökologische Nachhaltigkeit. Die deutsche Wirtschaft nutzt noch immer fossile Energieträger und emissionsintensive Produktionsprozesse. Zwar unterschritten die Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren oft die Zielwerte gemäß Klimaschutzgesetz. Dies geschah jedoch häufig durch krisenbedingte Sondereffekte wie Produktionsrückgänge und weniger durch eine strukturelle Transformation.
Dadurch kommt ein zeitweiliger Widerspruch zwischen ökonomischem Wachstum und ökologisch nachhaltigem Wirtschaften zum Ausdruck. Projektionen zeigen aber, dass dieser Konflikt nicht dauerhaft sein muss. Der Auf- und Ausbau von Schlüsselindustrien (z.B. Elektrolyseuren) sowie die Dekarbonisierung von Produktionsprozessen (z.B. durch die Elektrifizierung der Industrie) kann Emissionsminderungen mit wirtschaftlicher Stabilität und wachsendem Wohlstand verbinden.
Was muss in Zukunft passieren?
Staatliche Investitionen ausbauen
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen Nachholbedarf hat. Trotz zeitweilig hoher Bruttoinvestitionen blieben die Nettoinvestitionen weit unter dem notwendigen Niveau, sodass der Investitionsstau weiter angewachsen ist. Vor allem in den Kommunen bestehen große Nachholbedarfe, unter anderem bei Schulen, Verkehrsinfrastruktur und Wohnungsbau.
Hinzu kommt die notwendige klimaneutrale Gestaltung des öffentlichen Kapitalstocks, z.B. durch Investitionen in Energienetze. Studien gehen davon aus, dass für notwendige zusätzliche öffentliche Investitionen 600 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren aufgebracht werden müssten.
Da diese Summen nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können, ist eine Finanzierung über zusätzliche staatliche Kredite unvermeidlich. Das neue Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz eröffnet dafür neue Spielräume. Entscheidend ist nun, dass diese Mittel konsequent und zielgerichtet genutzt werden.
Zunehmender Bildungsarmut entgegentreten
Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit ist die wachsende Bildungsungleichheit eine zentrale Herausforderung. Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen ohne Sekundarstufe-II- oder Berufsabschluss, die sich auch nicht in Aus- oder Weiterbildung befinden (sogenannte Frühe Schulabgänger:innen), liegt mit über 13 Prozent deutlich über dem Zielwert und steigt in etwa seit 2015. Diese Entwicklung hat nicht nur individuelle Folgen in Form geringerer Teilhabe- und Einkommenschancen, sondern schwächt auch den Arbeitsmarkt, da dringend benötigte Fachkräfte fehlen und das Potential junger Menschen liegen bleibt.
Ursachen sind unzureichende Kompensation familiärer Benachteiligungen durch das Bildungssystem, Defizite bei der Berufsorientierung und die zusätzliche Belastung durch die Corona-Pandemie. Um dem entgegenzuwirken, sind unter anderem gezielte Investitionen im Bildungsbereich erforderlich, um Kindern aus sozial benachteiligten Familien bessere Bildungs- und Teilhabechancen zu eröffnen. Auch ist mehr Förderung während der Ausbildung erforderlich.
Dekarbonisierung voranbringen
Im Moment liegen die deutschen Treibhausgasemissionen unterhalb der im Klimaschutzgesetz festgelegten Zielwerte. Dieser Rückgang ist jedoch vor allem auf Kriseneffekte – etwa den Energiepreisschock und konjunkturelle Schwächen – zurückzuführen. Prognosen deuten darauf hin, dass die Verringerung der Emissionen auf diesem Weg nicht ausreichen wird, um die Ziele langfristig zu erreichen.
Ein zentrales Problem ist, dass die Investitionen in die Dekarbonisierung der Produktion derzeit stocken. Gleichzeitig gerät das deutsche Wirtschaftsmodell zunehmend unter Druck. Absatzmärkte in den USA und China verlieren an Bedeutung, während Deutschland und Europa bei Schlüsseltechnologien wie der Elektromobilität oder Batteriefertigung hinterherhinken. Dies gefährdet sowohl die Einhaltung der Klimaziele als auch die Grundlage für künftigen Wohlstand.
Um dieser doppelten Herausforderung zu begegnen, braucht es eine konsequente, koordinierte Wirtschafts-, Infrastruktur- und Industriepolitik. Entscheidend ist, die Dekarbonisierung aktiv zu forcieren, z.B. durch die Förderung von klimaneutraler Mobilität und die Förderung der Elektrifizierung der Industrie sowie Infrastrukturinvestitionen. So lassen sich Emissionsminderungen mit wirtschaftlicher Stabilität verbinden. Langfristig kann dieser Ansatz den scheinbaren Zielkonflikt zwischen Klimaschutz und wirtschaftlicher Stabilität entschärfen und sowohl ökologische als auch ökonomische Nachhaltigkeit sichern.



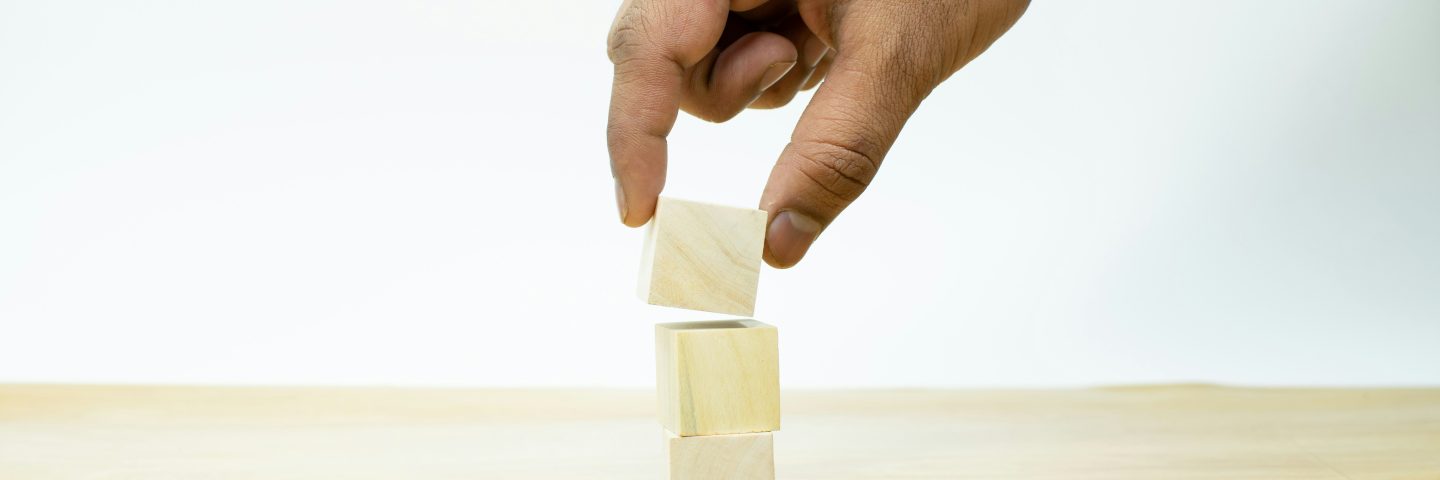





Kommentar verfassen