Geleitet wurde die Studie von Martina Schraudner. Sie ist an der TU Berlin und am Fraunhofer CeRRI tätig. Im Interview erzählt sie, was es braucht, damit Transferaktivitäten in Deutschland vermehrt gelingen können.
Frau Prof. Schraudner, in Ihrer Studie stellen Sie fest, dass Transferaktivitäten auf wenige, dafür besonders aktive Personen beschränkt sind. Gilt dies unabhängig von der Fachrichtung?
Ja, das gilt über alle Alters- und Karrierestufen hinweg. Es gilt auch unabhängig davon, ob sie an einer Uni oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung arbeiten oder auf welchem Fachgebiet. 85 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen ihre Arbeit als gesellschaftlich relevant ein – und ich denke, sie haben damit absolut recht. Beim Wissenstransfer über verschiedenen Disziplinen, Sektoren und Gruppen hinweg sticht nur eine Gruppe besonders hervor: die etablierten Professorinnen und Professoren im Alter von 45 bis 59 Jahren.
Unsere Untersuchungen haben ergeben: Je aktiver Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in einem Transferbereich sind, desto aktiver sind sie auch in allen anderen Bereichen, auch in der Wissenschaft. Umgekehrt sind gute Forschende oft auch gut im Transfer. Das eine bereichert das andere.
Wenn also die Motivation da ist, warum engagieren sich nicht mehr Forschende beim Transfer? Was machen andere Länder hier besser?
In der Schweiz zum Beispiel sind Patente für das Renommee von Forschenden genauso ausschlaggebend wie Veröffentlichungen. Es gibt die weitverbreitete Auffassung, dass in der Schweiz patentierte Ideen auch in der Schweiz unternehmerisch umgesetzt werden sollten.
Ich finde den Ansatz der CoARA wichtig, bei der Bewertung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die verschiedenen Ergebnisse, Praktiken und Aktivitäten anzuerkennen, die die Qualität und Wirkung der Forschung maximieren. Damit trägt Transfer ebenso wie Publikationen und eingeworbene Forschungsmittel zur Reputation bei.
Kommen wir zurück nach Deutschland. Welche konkreten Vorschläge haben Sie, um bei uns die Transfer-Aktivitäten von Forschenden zu erhöhen?
Hier muss ich vor allem erstmal klarstellen, dass wir unter Transfer nicht nur den Technologietransfer in die Wirtschaft und die Förderung von Start-ups verstehen. Es geht hier genauso um Politikberatung sowie die sogenannte Transdisziplinarität, also den Austausch mit der Gesellschaft. Darunter versteht man einerseits das Hineinwirken der Wissenschaft in die Gesellschaft. Andererseits kann die Gesellschaft der Wissenschaft bei der Identifikation relevanter Fragestellungen Impulse geben und auch ganz konkret mit in die Forschung einbezogen werden. Es geht bei Transfer immer um einen multidirektionalen Wissensaustausch.
Mir geht es besonders um die Förderung einer „Future Literacy“. Also um das Bewusstsein, dass die Zukunft nicht vorgezeichnet, sondern von uns allen gestaltbar ist.
Sind die Hürden für all diese Transferaktivitäten gleich hoch?
Es gibt natürlich überall spezifische Problemstellungen, aber tatsächlich hat unsere Untersuchung ergeben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Unterstützungsmaßnahmen, Anreizsysteme und die Wertschätzung für jede Art des Transfers insgesamt als eher schlecht bewerten.
Speziell erleben sie die Unterstützung durch Anlaufstellen, Programme, Netzwerkangebote, Trainings- und Weiterbildungsangebote, zeitliche und personelle Ressourcen sowie ihre Vorgesetzten mehrheitlich als schlecht. Zudem nutzen Forschungsorganisationen Anreizsysteme für Transfer durch finanzielle Prämien oder Karrierevorteile kaum.
Was könnte man hier ändern?
Die Bemühungen, die es in Bezug auf die Transferförderung gibt, sind noch nicht in der Breite angekommen. Auch weil die Initiativen die Nachfrage bei Weitem nicht befriedigen können. Das Interesse der Forschenden an Transferaktivitäten ist wirklich groß. Das zeigt beispielsweise das Interesse an niederschwelligen, weniger zeitintensiven institutionellen Social Media-Angeboten.
Deutsche Forschende beklagen die fehlende Wertschätzung für jede Art des Transfers. Wie ließe sich das ändern?
Hier sind die angelsächsischen Länder sehr viel weiter als wir. England, Australien, Neuseeland, Kanada und auch Hongkong verwenden dazu Begriffe wie Impact, Engagement oder Outreach und verbinden damit dezidierte Anreizsysteme. Wir haben das in unserer Studie übrigens einmal kurz und knapp zusammengefasst, weil wir das für extrem wichtig halten.
Im Vereinigten Königreich zum Beispiel wird im Research Excellence Framework, das Grundlage für die institutionelle Finanzierung universitärer Forschung ist, Impact so definiert: als Auswirkung, Veränderung oder Nutzen für die Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Politik oder öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Umwelt oder Lebensqualität jenseits der Wissenschaft. Das wird dann qualitativ bewertet.
Die Bewertung wird von Gutachterinnen und Gutachtern vollzogen, die an Fallbeispielen geschult wurden. Sie vergeben „Noten“, die dann direkt in die Förderentscheidungen einfließen. Es gibt aber auch vereinzelte Versuche, anhand bestimmter Indikatoren quantitativ den Impact von Forschung zu bestimmen, etwa anhand der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.
Ein anderer Ansatz, der zum Beispiel in Australien, Neuseeland und Kanada verfolgt wird, ist, die eigentlichen Transferaktivitäten zu bewerten und diese in Förderentscheidungen zu honorieren. Eine solche Transferaktivität könnte zum Beispiel eine Bürgerkonferenz sein.
Die eingeforderte Wertschätzung müsste doch aber auch aus der Wissenschaft selbst kommen.
Der Wissenschaftsrat in Deutschland sieht Transfer immerhin als Kernaufgabe von Forschungseinrichtungen an. Es gibt ein sehr interessantes Projekt eines wissenschaftlichen Verlagshauses: Der bekannte Verlag Elsevier arbeitet an quantitativen Impact-Indikatoren, wofür er seine eigene Datenbank mit externen Datenbanken kombiniert.
So kann Elsevier die klinischen, politischen und patentspezifischen Zitationen einzelner Fachartikel nachverfolgen und als vergleichbare Zahlenwerte darstellen. Im politischen Bereich nutzt Elsevier hierfür zum Beispiel die Datenbank Overton, die politische Dokumente aus 182 Ländern aggregiert. Wenn diese Indikatoren zukünftig etwa bei Berufungsverhandlungen eine Rolle spielen würden, hätten wir viel erreicht.
Welche Unterstützung können eigentlich Interessierte an der TU Berlin erwarten?
Als Professorin an der TU Berlin bin ich vielleicht etwas voreingenommen, aber ich glaube, dass wir hier schon sehr gute Unterstützung für Forschende anbieten. Es gibt die Stabsstelle Science and Society an der TU Berlin, die die Transferstrategie der Universität vor allem in den Bereichen Knowledge Exchange und Transdisziplinarität umsetzt. Zum Beispiel mit der Reallaborplattform StadtManufaktur Berlin.
Seit Ende 2023 können TU-Studierende ein Transferzertifikat erwerben, mit dem erstmals praxisnahe Kompetenzen im Bereich Wissens- und Technologietransfer von Absolventinnen und Absolventen direkt nachgewiesen werden können. Das Centre for Entrepreneurship der TU Berlin hat mit einem Coworking Space großen Anteil daran, dass wir regelmäßig – nach der TU München – den zweiten Platz belegen bei der Zahl der Start-ups, die aus einer Hochschule ausgegründet werden.
Und wir bringen unser Know-how auch in den Exzellenzverbund der drei Berliner Universitäten und der Charité – Universitätsmedizin Berlin ein. In dieser Berlin University Alliance entwickelt das sogenannte TD-Lab innovative Formate und begleitet Wissenschaftler:innen beim transdisziplinären Forschen. Zudem gibt es mit „Science and Startups“ jetzt auch eine gemeinsame Gründungsunterstützung der vier Verbundpartnerinnen.
Ich selbst habe im Forschungsprojekt „Transferwissenschaft“ mit Förderung durch das Bundesforschungsministerium und im engen Verbund zwischen dem Berliner „Center for Responsible Research and Innovation“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation und der Technischen Universität Berlin neuartige Transfermodelle untersucht. Die nun vorliegende Studie war Teil dieses Projekts. Ich hoffe sehr, dass sie nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland den Transferaktivitäten auf allen Ebenen vielfältige Impulse gibt.



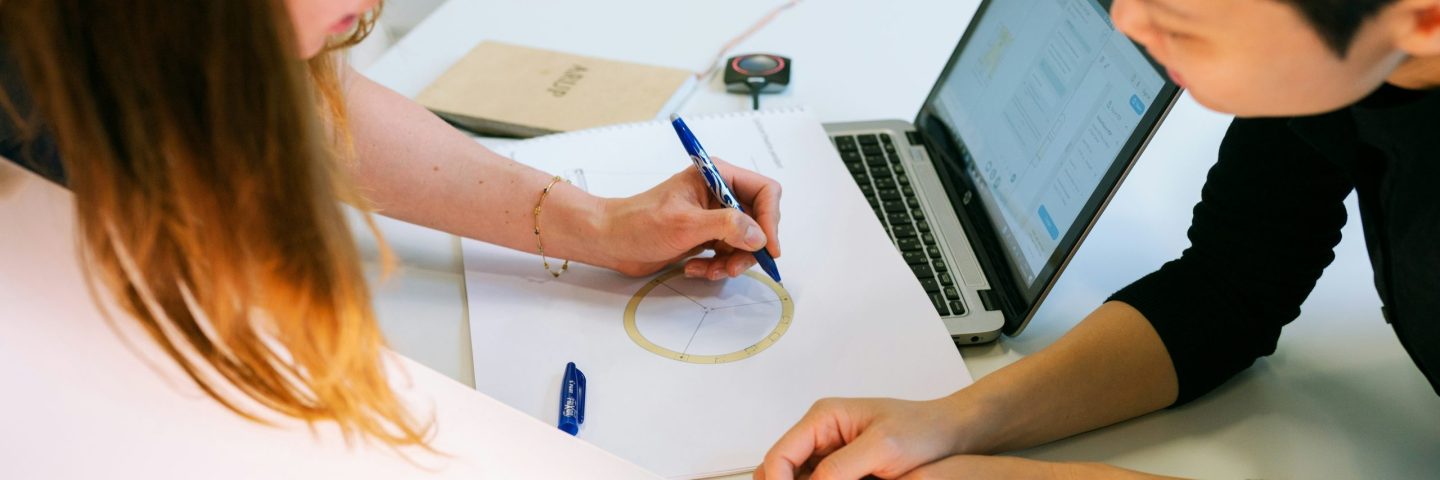




Kommentar verfassen