Wie können neue Innovationskulturen innerhalb staatlicher Strukturen aufgebaut werden? Wie wird die öffentliche Verwaltung zum aktiven Mitgestalter des Wandels?
Mit diesen und weiteren Fragen haben sich junge Vordenker:innen aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft im Rahmen des Netzwerks Voices of Economic Transformation der Bertelsmann Stiftung beschäftigt. Weitere Ideen finden Sie in dem Innovationskatalog, der dabei entstanden ist.
E-Government-Plattform: Basis für eine barrierefreie Verwaltung
Eine der größten Herausforderungen der digitalen Verwaltung ist die Fragmentierung bestehender Systeme: Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden nutzen häufig unterschiedliche Softwarelösungen, die nicht oder nur eingeschränkt miteinander kommunizieren können. Das führt dazu, dass Bürger:innen und Unternehmen sich auf unterschiedlichen Portalen mit jeweils eigenen Zugängen und Formularen anmelden müssen.
Eine zentrale E-Government-Plattform soll dieses Problem lösen. Sie vernetzt die verschiedenen Verwaltungsebenen technisch miteinander und ermöglicht den sicheren Austausch von Daten in standardisierten Formaten. So werden Prozesse beschleunigt, Doppelarbeiten reduziert und die Datenqualität erhöht.
Zusätzlich wird die Einführung einer digitalen Identität angestrebt. Mit dieser einheitlichen, sicheren Zugangsmöglichkeit können Bürger:innen und Unternehmen behördliche Leistungen mit nur einem Login nutzen – ohne mehrfach verschiedene Zugangsdaten verwalten zu müssen.
Die Umsetzung dieser Plattform erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die verbindliche Einhaltung technischer Standards sowie verpflichtende Schulungen für Verwaltungsmitarbeitende. Auch die Beteiligung von IT-Dienstleistern, Unternehmen und Akteuren der Zivilgesellschaft ist entscheidend, um eine technisch robuste, rechtssichere und auch inklusive Lösung zu schaffen.
Denn ein weiteres zentrales Merkmal der E-Government-Plattform sollte Barrierefreiheit sein. Das bedeutet, dass alle digitalen Angebote auch für Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt nutzbar sein müssen.
Kein Nice-to-have: Wie KI zu Inklusion beitragen kann
Denn in einer immer stärker vernetzten Welt ist Barrierefreiheit keine optionale Ergänzung mehr, sondern eine grundlegende Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Leider sind viele digitale Angebote – von Verwaltungsdiensten über Websites bis hin zu Apps – bislang für Menschen mit Behinderungen oft nur schwer oder gar nicht zugänglich. Dies schränkt nicht nur die soziale Teilhabe ein, sondern hat auch wirtschaftliche Folgen: Werden wichtige Nutzer:innen und Mitgestalter:innen ausgeschlossen, bleiben wertvolle Perspektiven und Innovationspotenziale ungenutzt.
Hier kann Künstliche Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle spielen. Durch Technologien wie Computer Vision und Natural Language Processing lassen sich Barrierefreiheitsfunktionen automatisieren – etwa durch automatisch generierte Bildbeschreibungen, Audiodeskriptionen, Textvereinfachungen oder Übersetzungen in Gebärdensprache. So werden Entwickler:innen entlastet und barrierefreie digitale Angebote erschwinglich und praktikabel.
Damit KI ihr volles Potenzial entfalten kann, ist jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft nötig. Forschungseinrichtungen entwickeln innovative Tools, Unternehmen bringen diese in marktfähige Produkte ein und testen sie gemeinsam mit NGOs und öffentlichen Stellen. Der öffentliche Sektor schafft mit Förderprogrammen und verbindlichen gesetzlichen Vorgaben den notwendigen Rahmen. Gleichzeitig spielen Menschen mit Behinderungen eine zentrale Rolle als aktive Mitgestalter:innen, die bei der Entwicklung und Bewertung neuer Lösungen eingebunden werden müssen.
Change Agents: Motivierte Mitarbeiter:innen als Schlüssel
Die digitale Transformation braucht Menschen, die Veränderung aktiv gestalten und vorantreiben. Auch bei der Modernisierung der Verwaltung reichen technische Systeme allein nicht aus. Hier kommen die sogenannten Change Agents ins Spiel – Mitarbeitende in Behörden, die eigenverantwortlich digitale Innovationen initiieren und umsetzen.
Damit diese Change Agents effektiv arbeiten können, ist eine systematische Förderung notwendig. Dazu gehört die gezielte Identifikation von Mitarbeiter:innen mit Innovationspotenzial, die Bereitstellung passgenauer Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme sowie die Einführung von Anreizsystemen wie finanziellen Boni, Anerkennung oder erhöhter Sichtbarkeit.
Wichtig ist auch, dass Change Agents politischen Rückhalt und Legitimation erhalten. Ohne Unterstützung aus der Führungsebene und klare Signale aus der Politik stoßen innovative Projekte oft auf Widerstände oder bleiben isoliert. Freiräume für Experimente und die Möglichkeit, neue Arbeitsweisen auszuprobieren, sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen.
Darüber hinaus spielen Weiterbildungsanbieter und Hochschulen eine zentrale Rolle, indem sie gezielte Schulungen und Zertifizierungen für digitale Kompetenzen entwickeln. Verbände wiederum unterstützen durch Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Beratung zur Entwicklung einer innovationsfreundlichen Kultur.
Kommunikation als Mittel zur Überwindung von Widerständen
Die Change Agents stehen bei ihrer Aufgabe mitunter aber auch vor kommunikativen Herausforderungen. Veränderung wird im öffentlichen Sektor häufig nicht ganzheitlich betrachtet. Unterschiedliche Teams oder Bereiche arbeiten mit eigenen Methoden, wodurch ein gemeinsamer roter Faden fehlt. Was soll mit welchem Ziel verändert werden? Fehlende Antworten führen zu Inkonsistenzen, Missverständnissen und Hemmnissen bei der Umsetzung neuer Technologien und Arbeitsweisen.
Ein praxisnaher Gesprächsleitfaden hilft Change Agents dabei, Kolleg:innen konstruktiv in den Wandel einzubeziehen. Er vermittelt konkrete kommunikative Methoden und bietet narrative Strategien, um Widerstände und Hemmungen zu erkennen, zu verstehen und motivierend anzusprechen.
Der Leitfaden wird in enger Zusammenarbeit mit Verwaltungsakteur:innen entwickelt und enthält praxisnahe Beispiele, Visualisierungen und Gesprächsszenarien. Er wird über Fortbildungsstellen, interne Netzwerke und digitale Plattformen verbreitet. Ergänzende Schulungen und Lernmodule erleichtern die Anwendung und unterstützen Change Agents darin, den Wandel wirksam zu begleiten.
Zusammenwirken von Mensch und Technik
Die Digitalisierung der Verwaltung erfordert ein integratives Vorgehen: Die technische Grundlage muss einen nahtlosen Austausch ermöglichen, nutzerorientiert und barrierefrei sein. Ferner braucht es motivierte und qualifizierte Change Agents, die den Wandel aktiv vorantreiben und Innovationen ermöglichen. So kann eine moderne, effiziente und inklusive Verwaltung entstehen, die den Anforderungen der Gesellschaft gerecht wird und bürgernahe Dienstleistungen auf hohem Niveau bietet.



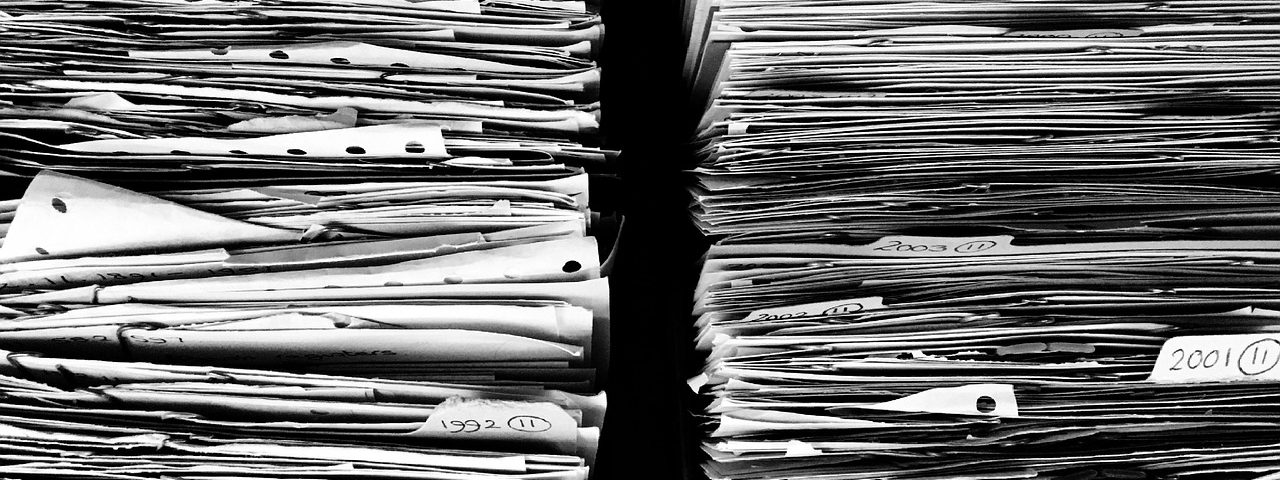





Kommentar verfassen