Täglich versprechen uns Unternehmen und Start Ups Innovationen, die die „Welt zu einem besseren Ort“ machen sollen, manchmal nehmen diese sogar den Begriff ”Revolution” in den Mund. Nichts geringeres soll eine gewisse Innovation nämlich auslösen, wie zum Beispiel eine Revolution der To-Go-Becher, oder eine Revolution der mobilen Datennutzung. Was Dutschke dazu wohl gesagt hätte?
Google ich also das Stichwort „Innovation“, finde ich ähnliches Weltbewegendes: beispielsweise einen Service, der jemanden vorbeischickt, um mein Auto vollzutanken, oder eine App, die mir Bier liefert.
Die Zukunft, die nie richtig zur Gegenwart wird
Ist das der Wandel, den unsere Welt braucht? Oder nur der, den sie verdient? Warum eigentlich sind Innovationen oft so banal? Große Herausforderungen haben wir doch, etwa Ungleichheit, Epidemien und den Klimawandel. Große Technologien wie Deep Learning, Nano-Sensoren und die CRISPR-Methode warten ebenfalls auf eine sinnvolle Nutzung. Wann geht’s also los? Das Sein bestimmt das Bewusstsein, sagte Marx. Was wir als lösenswertes Problem empfinden, hängt massiv von diesem „Sein“ ab. Ein MBA-Absolvent, der nun gründet, mag es als wertvoll empfinden, wenn jemand sein Auto volltankt und Bier vorbeibringt. Innovativ für ihn, sinnlos für die Welt da draußen. Was wirklich fehlt ist nicht Bier oder Benzin, sondern Empathie für relevante Bedürfnisse.
Innovation ist ein Entdeckungsprozess
Henry Ford würde dem entgegnen: „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde“. Mit Empathie ist es also noch lange nicht getan. Sonst tauscht man seine Ignoranz nur gegen die der Konsumenten. Wer hätte das Bedürfnis nach Telefonen äußern können, bevor es diese jemals gab? Oft zeigen Innovationen ihren Sinn erst im Laufe der Nutzung. Das Telefon wollte Edison eigentlich nur für Opernübertragungen einsetzen. Viele Entdeckungen folgen dieser Logik: Man sucht nach dem Vorstellbaren (neuer Weg nach Indien) und findet das Neue, Unvorstellbare (Amerika). Innovationen brauchen also einen Möglichkeitsraum, eine Bereitschaft für Überraschungen und oft auch erstmal eine Zweckfreiheit. Wieviel Innovationen sind entstanden, weil man Wissenschaftler*innen einfach eine Menge Cash gegeben und sie dann (noch wichtiger!) in Ruhe gelassen hat? Aber wie viele Unternehmer*innen fahren an Amerika vorbei, weil sie Indien suchen?

© Foto: Gerd Altmann – Pixabay
Regelt doch nicht immer alles
Zurück zu Services, die mein Auto und mich volltanken. Das Problem sind auch fehlgeleitete ökonomische Anreize. Eine Innovatorin findet kurzfristig einen größeren Markt für On demand fuel delivery services als für sauberes Trinkwasser. Nach Marktlogik haben die mit den wenigsten Problemen das meiste Geld, um ihre Pseudo-Probleme lösen zu lassen. Das bringt viele schlaue Köpfe dazu, ihre Zeit mit Tank-Apps zu verbringen und nicht mit Trinkwasser-Lösungen. Vielleicht regelt der Markt eben doch nicht alles?
Aber wohin soll’s gehen?
Wenn wir uns Weltbewegendes wünschen, müssen wir auch nach der Richtung dieser Bewegung fragen. Fortschritt ist uns heilig. Aber welcher Gott steckt hinter dem Heiligenschein? Wohin schreiten wir eigentlich fort? Gerade bei digitalen Innovationen scheint Fortschritt nur darin zu bestehen, noch grenzenloser zu surfen und Laptops zu bauen, dünn wie eine Scheibe Emmentaler. Was fehlt, ist sozial ausgehandelte Zukünftigkeit.
Spulen wir etwas zurück: Im 19. Jahrhundert mussten die verheerenden Nebenwirkungen der industriellen Fabrikationssysteme eingehegt werden. Unter Kämpfen wurde dem proletarischen Elend innovativ begegnet: Arbeiterbildungsvereine, Gewerkschaften, Gesundheits- und Sozialvorsorge. So konnte der Wandel sozial aufgefangen werden. Die Maßnahmen folgten dabei stets einem pragmatisch-gesamtgesellschaftlichen Fortschrittsideal. Dieses sicherte die Stabilität von Gesellschaften in Phasen massiver Umbrüche.
Lassen sich daraus Hinweise für die gegenwärtigen Probleme entnehmen? Welchen Fortschrittsbegriff können wir unserem veralteten Arbeits- und Bildungsbegriff, dem Vertrauensverlust in etablierte Systeme oder der gesellschaftlichen Ungleichheit entgegensetzen? Was ist unser Ideal von Zukunft? Und dann: Welche Innovationen können wir auf dieses Ziel lenken?
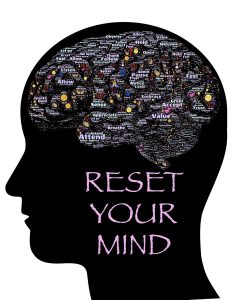
© Foto: John Hain – Pixabay
Auf der Suche nach dem guten Fortschritt mit Transform
Wir beim Transform Magazin sehen uns nicht als Innovator*innen, auch nicht als Unternehmer*innen. Was wir aber wollen, ist im Vorfeld von sozialen Innovationen zu wirken. Wir wollen diese Anstöße für einen gesellschaftlichen Wandel geben, ein Umdenken dafür schaffen. Dafür schreiben wir als Kollektiv ein Magazin. Wir wollen im Magazin beitragen die Gesellschaft achtsamer, genussvoller und besser zu gestalten. Dafür haben wir uns die oben genannten Prinzipien für wirkliche Innovation zu Herzen genommen.
Das Gute Leben, unser Fortschrittsideal
Unser Purpose, wenn man das mal so neudeutsch sagen möchte, ist es ein Magazin für das Gute Leben zu sein. Der Begriff gut erlaubt eine gewisse Offenheit. Er ist kein Eigenschaftswort wie grün, glücklich oder erfolgreich. Gut ist eine Frage der Perspektive. Die Frage ist gut wofür? Die Brille ist gut, wenn ich durch sie scharf sehen kann. Das Messer ist gut, wenn es schneidet. Das Leben ist gut, wenn …? Hier ist eine philosophische Weggabelung: Man kann nun “Gut” mit einer Eigenschaft wie “erfolgreich” füllen. Doch dann ist man in der Falle, dass man vordefinierten Zielen nachjagt. Dadurch erkennt man das Potential der Überraschungen, die einem das Leben zweifelsohne bietet, nicht. Oder man nutzt dieses Wort “gut” als einen Platzhalter und sagt sich: Lass es uns probieren, was gut für uns ist. Der Brille sehe ich vorher nicht an, ob sie “gut” ist. Nein, ich muss sie aufsetzen, um dann möglicherweise festzustellen “Oh, die ist aber gut”. So stellt man auch im Leben oft erst im Rückblick fest, es ist gut, wie es ist. Das Gute Leben ist also mehr Frage als Antwort. Das bedeutet Offenheit.
Fürs Gute Leben sein bedeutet, sich selbst auch damit zu überraschen, was man als gut empfinden wird. Jemand der nie Kinder haben wollte, und dann ungewollt Mutter wird und herausfindet, dass es gut ist. Jemand der nach dem Studium nie wieder in der Gastronomie arbeiten wollte und jetzt sein eigenes Café eröffnet, und fühlt, dass es gut ist. Auch unseren Leser*innen gegenüber versuchen wir diese Offenheit zu ermöglichen: Für die einen ist das gute Leben sich Unabhängigkeit zu schaffen und autark zu sein, für anderen sich mehr einzumischen und mehr mitzugestalten.

Werbefreiraum als Raum für neue Ideen
Ein wichtiger Grundsatz, um über das gute Leben nachzudenken ist Freiraum. Das Ziel, um mit Foucault zu sprechen, ist heute oft nicht zu entdecken, wer wir sind, sondern erstmal abzulehnen, wer wir sein sollen. Ein Kernstück unseres Ansatzes ist es deshalb, werbefrei zu sein. Wir haben viele Autor*innen von großen Zeitungen und Verlagen, die bei uns Texte schreiben, für die ihnen woanders gesagt werden würde, dass sie “doch bitte ein werbefreundlicheres Umfeld” schaffen sollen. Unsere Leser*innen spielen uns zurück, wie wohltuend es ist ein Heft durchzublättern, wo einem nicht implizit auf jeder zweiten Seite gesagt wird, dass man zu schlecht gekleidet, nicht erfolgreich genug oder zu dick sind. Denn das ist es, was Werbung in nuce macht. Wenn man durch so einen werbefreien Raum blättert, wer weiß, ob man dann nicht auch auf Ideen kommt, die mehr sind als nur eine App, die dir Bier bringt?
Empathie, wo es wehtut
Wahre Innovation muss dahin gehen, wo es wehtut. Wo Spannungsfelder gelöst werden können. In unserer Ausgabe “Empathie, da wo es weh tut” begaben wir uns auf einen AfD Stammtisch und sprachen mit einer Organisation, die IS-Rückkehrer*innen integriert.
Und wir provozierten uns selbst: Weil man als ‘grünes Feelgood Magazin’ immer Gefahr läuft, den ohnehin schon Gläubigen in den Prenzlauer Bergs dieser Republik zu predigen, drehten wir in den letzten Ausgaben den Spieß um und wählten Themen aus, die uns schwer fallen, die uns also dazu herausforderten eine Empathie zu anderen Haltungen aufzubauen. Eine Ausgabe drehte sich um das Thema “Wer braucht noch Kinder?”, wo wir Menschen interviewten, die sich sterilisieren ließen, und wo wir die fatale Ökobilanz des Kinderkriegens aufzeigten. Nimm das, Prenzlauer Berg!

In der neuen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Frage, ob eine nachhaltigere Gesellschaft nicht auch so etwas wie eine neue Religion braucht. Nicht leicht für unsere Redaktion, die in ihrem Atheismus oft fundamentalistischer ist, als die katholische Kirche in ihrem Glauben. Kamen wir aus den Spannungsfeldern wieder heraus, waren wir ein Stück weit verwandelt, haben uns sozusagen selbst innoviert. Und die Leser*innen vielleicht auch?








Kommentar verfassen