Gut ausgebildete Fachkräfte sind für die technologische Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft elementar. Unternehmen brauchen qualifiziertes Personal, um wettbewerbsfähig zu bleiben und innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Höher qualifizierte Beschäftigte steigern dabei nicht nur die Produktivität, sondern erhöhen die Innovationskraft und das Wirtschaftswachstum.
Bildung und Qualifikation sind daher die Grundlage für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum. Die zentralen Entwicklungen – von der Studiennachfrage über Hochschulabschlüsse bis zur Weiterbildung – werden in einem aktuellen Bericht zusammengefasst. Ergänzend lassen sich verschiedene Empfehlungen für Politik und Praxis ableiten, um die Qualifikationsstruktur in der Erwerbsbevölkerung nachhaltig zu verbessern.
Empfehlungen für die Bildungspolitik und -praxis
Inländische Studierpotenziale effizienter ausschöpfen, z. B. Studienorientierung an Schulen stärken, MINT-Förderung frühzeitig und gezielt ausbauen, zielgerichtete Förderung für nicht-akademische Haushalte, Abbruchraten durch frühzeitige Beratung verringern
Internationale Studierende aktiv anwerben und integrieren, z. B. Sichtbarkeit deutscher Hochschulen erhöhen, Anerkennung von Abschlüssen erleichtern, Willkommenskultur stärken, Diskriminierung entgegenwirken
Weiterbildung gezielt ausbauen – besonders für kleine Unternehmen und Erwerbslose, z. B. bürokratiearme Förderung, individuelle Beratung, arbeitsmarktorientierte Angebote
Relativ wenig Akademiker:innen in Deutschland
Im Jahr 2023 hatten 36 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland einen Hochschulabschluss, ein deutlich geringerer Anteil als in vielen anderen hochentwickelten Ländern, wo bis zu 77 Prozent erreicht werden. Der Trend zur Höherqualifizierung verläuft hierzulande eher langsam (Anstieg um 4 Prozentpunkte in der letzten Dekade).
Zudem hat in Deutschland – anders als in vielen Vergleichsländern – der Anteil der Geringqualifizierten zugenommen. Dies ist in dem lange Zeit stabilen wirtschaftlichen Umfeld begründet, in dem auch Jobs für Menschen mit niedriger formaler Qualifikation entstanden sind.
Um das Qualifikationsniveau der Erwerbsbevölkerung zu steigern, kann die Teilhabe an akademischer Bildung strukturell verbessert werden. Mögliche Maßnahmen hierzu sind:
- Abbau von Barrieren für den Hochschulzugang
- eine gezielte Verbesserung der Studienfinanzierung
- mehr berufsbegleitende Studienangebote
- Angebote auch „unterhalb“ der akademischen Qualifizierung, z. B. durch eine Qualifizierungsoffensive für Erwachsene ohne Berufs- oder Studienabschluss
Stabiles Potenzial an Studienberechtigten
Die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger mit Hochschulzugangsberechtigung ist ein wichtiger Frühindikator für die künftige inländische Studiennachfrage. Ihr Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung (Studienberechtigenquote) ist zwischen 2000 und 2015 deutlich gestiegen – von rund 37 auf etwa 53 Prozent eines Jahrgangs.
Seit 2016 gehen die Zahlen aber zurück. Im Jahr 2023 lag die Quote bei 47 Prozent. Bundesweit gab es knapp 380.000 neue Studienberechtigungen – rund 73.000 weniger als im Rekordjahr 2016. Verschiedene Ursachen kommen hier zum Tragen: So gibt es schlichtweg weniger Schulabgängerinnen und -abgänger durch die veränderliche Demografie. Aber auch die Beteiligung an Bildungsgängen, die zur Hochschulreife führen, ist gesunken.
Langfristig gibt es jedoch Anzeichen für eine Trendwende: Durch wieder stärker besetzte Altersjahrgänge ist ein moderater Anstieg ab 2027 zu erwarten. Für das Jahr 2035 werden über 455.000 studienberechtigte junge Menschen erwartet – bei einer voraussichtlichen Quote von 52 Prozent. Das könnte der Studiennachfrage neuen Auftrieb geben.
Studienorientierung an Schulen verbessern
Um die wieder steigenden Studierpotenziale nachhaltig zu nutzen und auch den Studienabbruch zu verringern, sollte vor allem die frühzeitige und passgenaue Studienorientierung an Schulen verbessert werden. Dazu beitragen können:
- eine frühzeitige Studien- und Berufsorientierung durch bessere Informationen über Studiengänge, Anforderungen und Berufsperspektiven, zu der auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schulen, Hochschulen und Berufsberatung zählt
- der Ausbau von Orientierungssemestern und Schnupperstudien (z. B. in MINT-Fächern)
- die Unterstützung von Schüler:innen aus nicht-akademischen Haushalten durch Mentoring- und Förderprogramme
- die Nutzung von Digitalisierungsmöglichkeiten (z. B. Studienwahltests, Online-Plattformen mit Erfahrungsberichten)
Starke Studiennachfrage durch internationale Studierende
Die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich zugenommen: Haben im Jahr 2000 noch knapp 315.000 junge Menschen ein Studium begonnen, waren es 2023 bereits etwa 482.000. Dieser beachtliche Anstieg spiegelt den großen Bedeutungsgewinn der akademischen Ausbildung wider.
Besonders auffällig: Die Zahl internationaler Studienanfängerinnen und -anfänger steigt seit Jahren und erreichte 2023 einen neuen Höchststand: Fast ein Viertel der Studienanfänger:innen kam aus dem Ausland (zum Vergleich: im Jahr 2000 waren es noch 14 Prozent).
Auch in der Wahl der Studienfächer zeigen sich interessante Trends: Informatik legt weiterhin zu und macht 2023 bereits 9 Prozent aller Studienanfänge aus. Dagegen setzt sich der rückläufige Trend im Maschinenbau fort – sein Anteil sank auf 6 Prozent. Insgesamt entschieden sich 37 Prozent der Studienanfängerinnen und -anfänger für ein Fach aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).
Besonders die internationalen Studierenden treiben diese Entwicklung: Studieninteressierte aus dem Ausland entscheiden sich überdurchschnittlich häufig für ein MINT-Fach, was die Relevanz der internationalen Studierenden hervorhebt: Denn die MINT-Fächer sind von besonderer Bedeutung bei der technologischen Innovationsfähigkeit. Daraus lassen sich folgende Handlungsempfehlungen geben:
- Internationale Studierende gezielt anwerben und fördern, ihre soziale Integration in die Hochschulen unterstützen und Diskriminierung aktiv entgegenwirken, z. B. durch Awareness-Schulungen an Hochschulen
- Interesse an MINT-Fächern wecken, speziell mit Blick auf bisher in den MINT-Fächern unterrepräsentierte Gruppen
Viele Studienabschlüsse im MINT-Bereich
Im Jahr 2023 wurden an deutschen Hochschulen über 500.000 Abschlüsse vergeben, darunter knapp 300.000 Erstabschlüsse. Besonders stark sind die MINT-Fächer in höheren Qualifikationsstufen vertreten: Während bei den Erstabschlüssen die Ingenieurwissenschaften knapp ein Viertel und die Naturwissenschaften 8 Prozent ausmachen, liegen ihre Anteile bei Masterabschlüssen und Promotionen deutlich höher. Im internationalen Vergleich hat Deutschland mit einem MINT-Anteil von 35 Prozent nach wie vor eine Spitzenposition.
Zahl internationaler Absolvent:innen wächst
Auch die Zahl internationaler Absolventinnen und Absolventen wächst weiter: 2023 schlossen knapp 59.000 ausländische Studierende ein Studium in Deutschland ab – das entspricht 12 Prozent aller Hochschulabschlüsse. Besonders hoch ist ihr Anteil bei Master- und Promotionsabschlüssen sowie in MINT-Fächern. So sind knapp ein Drittel der naturwissenschaftlichen Promotionen und ein Viertel der Masterabschlüsse in Ingenieurwissenschaften international besetzt. Die meisten kommen aus Asien und dem Pazifikraum – vor allem aus China (14 Prozent) und Indien (13 Prozent).
Angesichts des zunehmenden Fachkräftebedarfs kann das Potenzial internationaler Absolventinnen und Absolventen eine Schlüsselrolle spielen. Studien zeigen: Rund 40 Prozent von ihnen leben auch zehn Jahre nach Studienbeginn noch in Deutschland – insbesondere jene mit MINT-Abschlüssen. Das unterstreicht die strategische Bedeutung internationaler Hochschulbildung für die Fachkräftesicherung.
Um das Fachkräftepotenzial internationaler Absolventinnen und Absolventen besser zu nutzen und ihre Bleibechancen gezielt zu erhöhen, sind gezielte Maßnahmen hinsichtlich des Bildungs- und Berufseinstiegs notwendig:
- Unterstützung von internationalen Studierenden beim Übergang in den Arbeitsmarkt, z. B. durch Praktika, Bewerbungstrainings, Karriereberatungen und Kooperationen mit Unternehmen
- Deutschkenntnisse früh und praxisnah fördern, z. B. Sprachkurse als integraler Bestandteil des Studiums – mit Fokus auf beruflicher Kommunikation
Nach Corona: Wieder steigende Weiterbildung
In Zeiten des technologischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels hat auch die Weiterbildung zentrale Bedeutung – sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen. Sie sichert Beschäftigungsfähigkeit, fördert Innovationskraft, stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit und ist ein strategisches Instrument, um Kompetenzen im Unternehmen zu sichern und Mitarbeitende langfristig zu binden.
Zwar ist die individuelle Weiterbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen mit durchschnittlich 5 Prozent im Jahr 2023 stabil, allerdings stagniert das Niveau bei Hochqualifizierten seit Längerem. Positiv ist dagegen die steigende Beteiligung unter qualifizierten Erwerbslosen.
Auch die betriebliche Weiterbildung war über viele Jahre auf Wachstumskurs – insbesondere kleine und mittelgroße Betriebe holten seit den 2000er Jahren stark auf. Während große Unternehmen traditionell hohe Quoten von über 90 Prozent aufweisen, erreichten kleinere Betriebe 2019 erstmals Werte über 50 Prozent.
Die Covid-19-Pandemie sorgte jedoch für einen deutlichen Rückschlag. Erst 2022 begann die Erholung, wobei das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht wurde. Gerade in kleinen Unternehmen besteht also ungenutztes Potenzial.
Um die Weiterbildung als zentrales Instrument zur Fachkräftesicherung, Innovationsförderung und Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu stärken, sind folgende politische Maßnahmen empfehlenswert:
- Weiterbildungsangebote ausbauen und insbesondere kleine Unternehmen darin unterstützen, bestehende Angebote und Förderprogramme in Anspruch zu nehmen
- Flexible und praxisnahe Formate etablieren und dabei insbesondere Digitalisierungsoptionen nutzen
- Erwerbslose aller Qualifikationsstufen stärker in Qualifizierungsmaßnahmen einbinden, z. B. durch individuelle Qualifizierungsberatung in der Arbeitsförderung und passgenaue Weiterbildungsangebote mit direktem Bezug zum Arbeitsmarktbedarf
Hintergrund der Studie
Seit 2008 berät die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) die Bundesregierung in wissenschaftlichen Fragen rund um Forschung, Innovation und Technologie. In ihren jährlichen Gutachten analysiert sie systematisch die Stärken und Schwächen des deutschen Innovationssystems im internationalen Vergleich.
Der dem Beitrag zugrundeliegende Bericht wurde im Auftrag der EFI erstellt, wobei die Analyse und Interpretation in der Verantwortung der beauftragten Forschungseinrichtungen liegt: dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und dem Center für Wirtschaftspolitische Studien (CWS) der Leibniz Universität Hannover.



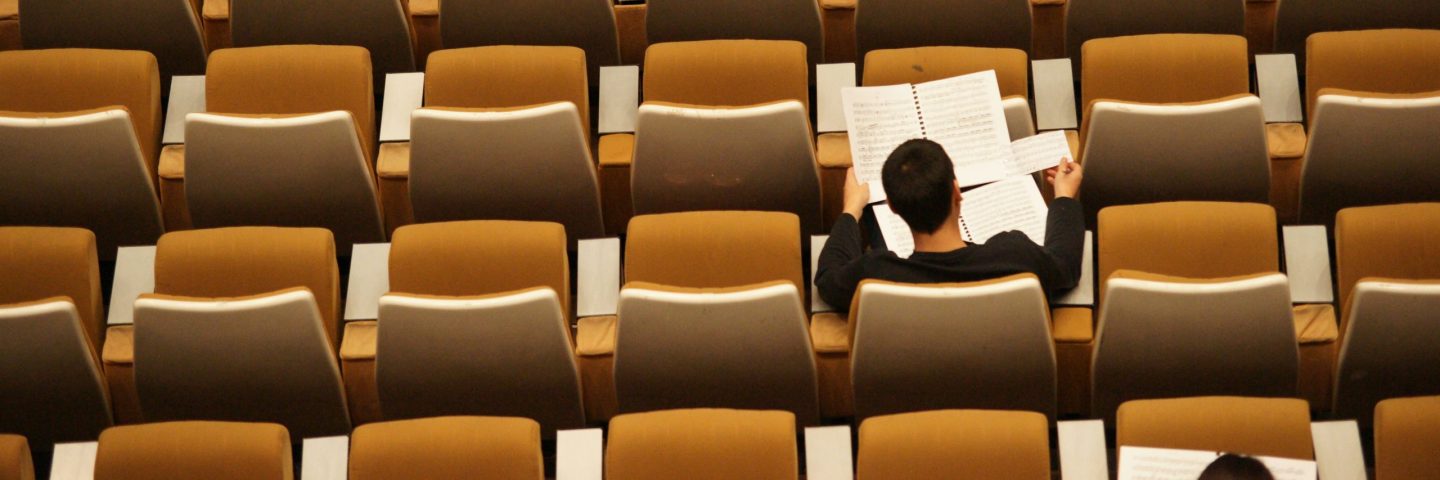




Kommentar verfassen